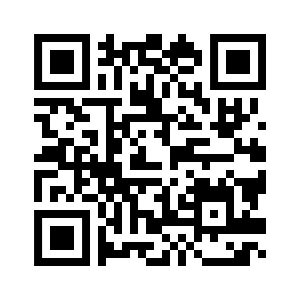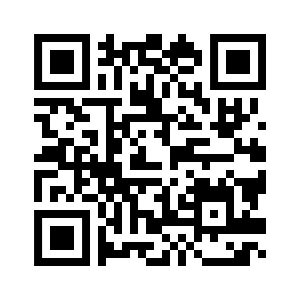
| AP1 PC-gestützt: Informationstechnisches Büromanagement |
| 120 Minuten | 25% |
| AP2 schriftlich: Kundenbeziehungsprozesse |
| 150 Minuten | 30% |
| AP2 schriftlich: Wirtschafts- und Sozialkunde |
| 60 Minuten | 10% |
| AP2 mündlich: Fallbezogenes Fachgespräch | - | 20 Minuten | 35% |
| Vermittlung | Zielorientierung | ||
|---|---|---|---|
| Medienkritik | Medienkunde | Mediennutzung | Mediengestaltung |
|
|
|
|
E-Learning ist eine Form des Lernens, bei der elektronische bzw. digitale Medien eingesetzt werden.
Diese Medien können den klassischen Unterricht bereichern (Blended Learning*) oder ersetzen (nicht für jeden und nicht für jedes Thema geeignet).
Mynd
*Unter Blended Learning versteht man auch die Kombination von Präsenz- und Fernunterricht bzw. Lernen im Homeoffice (mithilfe von E-Learnings).
Der Einsatz elektronischer Medien ist nicht ganz neu.
Weit verbreitet waren lange Zeit Lehrfilme auf Videokassetten (gerne eingesetzt im Biologie-Unterricht), Kassetten oder CDs im Sprachunterricht und die Technik im Sprachlabor.
Später kam der Einsatz von PowerPoint-Präsentationen ins Klassenzimmer.
Damit die Inhalte gut aufgenommen werden, sollten die E-Learnings an die Zielgruppe angepasst sein.
Als Medien kommen neben (zum Teil interaktiven) PDF-Dateien, PowerPoint-Präsentationen, programmierten Tests bzw. Quizzen und spezialiserten Tools oft Lernvideos, Erklärvideos bzw. Erklärfilme zum Einsatz.
Microlearning ist eine Lernmethode, bei der Lerninhalte in kleinen Lerneinheiten konzipiert werden, um Lernenden innerhalb von wenigen Minuten Wissen zu vermitteln.
Diese Lerneinheiten (meistens eine bis drei, maximal fünf Minuten lang) werden Learning Nuggets genannt.
Sehr bekannte deutschsprachige Beispiele hierfür sind: Studyflix, simpleclub und explainity.
Vorteile:
Nachteile:
Die Gruppenaufteilung erfolgt durch die Wahl der farbigen Origami-Blätter.
Jede der drei Gruppe überlegt sich 20 interessante, nicht zu einfache Fragen zum Thema Gesundheit. Dabei ist es wichtig, dass jeder Gruppenteilnehmer (m/w/d) diese beantworten kann. Entscheidungsfragen (Ja/Nein) sind tabu. Geschlossene Frage, bei der nach konkreten Zahlen (Jahreszahlen, Anzahl der Knochen, Muskeln, Zähne etc.) gefragt werden, sind zwar erlaubt, führen aber ggf. zu Unmut bei den anderen Gruppen, außer man macht eine Schätzaufgabe daraus und vergibt sich damit selbst die Chance, den Punkt für sich zu gewinnen, da der an die Gruppe geht, die am dichtesten geschätzt hat.
Das Internet darf zu Recherche-Zwecken genutzt werden. Die Fragen werden in MS Word geschrieben und ausgedruckt oder handschriftlich notiert.
Aus der ersten Gruppe kommt ein Teilnehmer nach vorne und liest eine Frage vor. Jetzt haben die anderen Gruppen eine Minute Zeit, gruppenintern über eine Antwort zu diskutieren. Die Gruppe, die nach Ablauf der Zeit (oder schon vorher) glaubt, die Frage beantworten zu können, ruft lauft „Hier!“ (oder so).
Die fragende Person zeigt dann willkürlich auf jemanden aus der Hier-Gruppe, der dann die Frage beantworten muss. Melden ist erlaubt, muss aber nicht beachtet werden. Ist die Antwort richtig, bekommt die antwortende Gruppe einen Punkt. Ist die Antwort falsch, darf die andere Gruppe antworten. Auch hier wird die antwortende Person von der fragenden gewählt. Pro Runde darf jede Gruppe nur einmal antworten.
Weiß keine Gruppe die richtige Antwort, zeigt die Spieleleitung auf jemanden aus der fragenden Gruppe, der dann (vermutlich) die richtige Antwort nennt. Dann stimmen die anderen Gruppen darüber ab, ob sie die Frage (und die Antwort natürlich) interessant fanden. Wenn mindestens ein Viertel der Teilnehmer aus den anderen Gruppen sich für „interessant“ melden, bekommt die fragende Gruppe einen Punkt. Sonst bekommt die fragende Gruppe nichts.
Die Gruppen wechseln sich mit den Fragen ab, bis alle Gruppen alle Fragen vorgetragen haben. Innerhalb der Gruppe wechseln sich die Teilnehmer mit dem Vortragen ab.
Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.
Idee: Oliver Klee (Spielereader) TimerZum Selbstlernen mit Aufgaben und Lösungen
Ggf. Seite aktualisieren, wenn der Browser behauptet, die Seite wäre nicht da (404).
ab Seite 1 Grundrechenarten - ab Seite 7 Rechenregeln - ab Seite 15 Dezimalbruchrechnung - ab Seite 21 Bruchrechnung - ab Seite 30 Ganze Zahlen - ab Seite 42 Prozentrechnung - ab Seite 48 Zinsrechnung - ab Seite 56 Dreisatz - ab Seite 65 Gleichungen - ab Seite 71 Dreiecke - ab Seite 79 Satz des Pythagoras - ab Seite 87 Längen- und Flächenberechnungen - ab Seite 94 Körperberechnungen - ab Seite 104